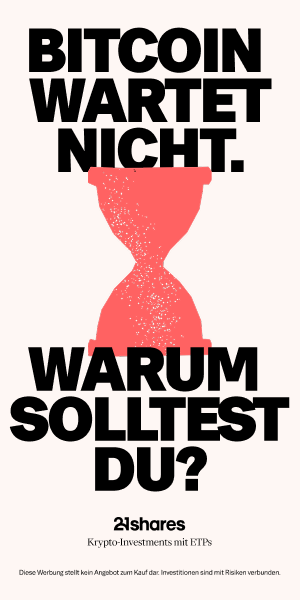Nachhaltigkeit: saubere Sache oder Etikettenschwindel?
Verantwortungsvolles Anlegen ist „in“, die Produktvielfalt nimmt zu, aber nicht jedes Investment ist sinnvoll. (14.02.)
Christian Euler, Frankfurt. Ethische Geldanlagen, Green Money oder Social Responsible Investment: Nachhaltigkeit kennt viele Begriffe. Das Kürzel ESG wiederum steht für Environmental, Social und Governance, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.
Laut dem Marktbericht 2018 des Branchenverbands „Forum Nachhaltige Geldanlagen“ belief sich die Summe des nachhaltig angelegten Kapitals Ende 2017 in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf 171 Mrd Euro. In Österreich machten derartige Fonds und Mandate stolze 8,3 % am Gesamtmarkt aus.
„Nachhaltigkeit in den Portfolios gewinnt weiter an Bedeutung“, resümiert Olaf John, Head of Business Development Europe bei Insight Investment, „die überwiegende Mehrheit der europäischen Investoren plant, in den nächsten drei Jahren die ESG-Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung deutlich zu erhöhen.“ John sieht in den sogenannten „ESG-Themen“ wichtige Treiber für den Wert einer Kapitalanlage und geht davon aus, dass diese Faktoren bei der Analyse von Unternehmen und Ländern in den kommenden Jahren stärker an Bedeutung gewinnen werden.
Angesichts des schnell wachsenden Angebots an Investmentprodukten fragen sich viele Anleger: Wie grün sind Nachhaltigkeitsfonds wirklich? Tatsache ist: Das einst zarte Pflänzchen dieser Investmentspezies ist längst zu einem kaum durchdringbaren Dschungel geworden. Ebenso wenig überschaubar ist die Vielzahl an Ratings, Kennziffern und Gütesiegeln, die Nachhaltigkeit bescheinigen sollen. „Es ist nicht alles grün, was mit diesem Label versehen wird“, bringt es Jon Sigurdsen auf den Punkt. Als leitender Portfoliomanager im Bereich erneuerbare Energien bei DNB Asset Management weiß Sigurdsen, von was er spricht. Die norwegische Investmentboutique lancierte vor 30 Jahren den ersten nachhaltigen Anlagepool. „Investoren finden in ihren Fonds immer wieder Aktien von Firmen vor, die nur vorgeben, nachhaltig zu handeln“, berichtet der Experte.
Unter Kapitalmarktprofis kursiert dieses Phänomen unter dem Begriff „Greenwashing“. Ein Beispiel: Viele ökologisch angehauchte Fonds investieren in den Online-Handel, weil diese Firmen meist große Gewinne erwirtschaften, aber nur wenig direkte Kohlendioxid-Emissionen verursachen. „Für uns hat das weniger mit Nachhaltigkeit zu tun, weil die Online-Anbieter Zusteller und Partnerfirmen rund um den Globus schicken, die wiederum für Emissionen verantwortlich sind“, sagt Branchenkenner Sigurdsen.
Die kaum mehr zu überblickende Bandbreite der mittlerweile mehr als 1.600 Investmentfonds, die allein in Europa unter dem Prädikat „nachhaltig“ firmieren, sorgt bei vielen Investoren für Verwirrung – zumal Transparenz und Mindeststandards häufig auf der Strecke bleiben.
Anleger sollten daher genau darauf achten, wie das Depot zusammengesetzt ist und wie streng die Auswahlkriterien sind. Weniger Einschränkungen gibt es beispielsweise beim sogenannten Best-in-Class-Prinzip: In den Anlagetopf wandern Aktien von Unternehmen, die in ihrem jeweiligen Sektor Klassenbeste beim Thema Nachhaltigkeit sind. So können auch Titel von Ölproduzenten oder Atomkraftwerksbetreibern enthalten sein, solange sie nur sauberer wirtschaften als die Konkurrenz.
„Schon ein Blick auf die zehn größten Positionen kann deutlich machen, wie ,Grün’ ein Fonds tatsächlich ist“, meint DNB-Portfoliomanager Sigurdsen.
Ein Anhaltspunkt können auch Anlageprodukte sein, denen das Siegel des „Forum Nachhaltige Geldanlagen“ verliehen wurde. Es basiert auf einem gleichermaßen strengen wie transparenten Ansatz und setzt im deutschsprachigen Raum die Vorgaben des europäischen Dachverbands für nachhaltige Geldanlage um.
Hilfreich ist auch ein Blick in den Nachhaltigkeitsbericht des Fondsanbieters. Hier wird schnell klar, ob sich das Unternehmen auch selbst strenge Auflagen setzt.
Foto: hankimage9/Fotolia.com