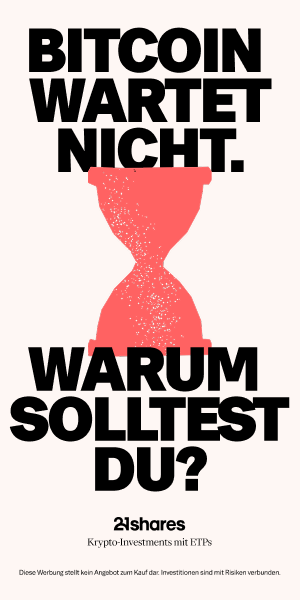Wer bezahlt die Pandemie?
Agenda-Austria-Chef Franz Schellhorn und die Wege aus der Krise.
Manfred Kainz. Noch ist das gesamte private und öffentliche Leben überlagert von der Pandemie. Besonders auch die Wirtschafts- und Finanzpolitik. Denn eine Frage wird angesichts der riesigen budgetpolitischen Lasten und Herausforderungen immer virulenter: Wer bezahlt die Krise?
Um diese Frage annäherungsweise beantworten zu können, muss man wohl einen Schritt zurücksetzen, um einen breiteren Blick auf das Gesamtszenario zu haben.
Drei „zentrale Fehleinschätzungen“ in der politischen Diskussion ortet etwa Franz Schellhorn, Direktor des unabhängigen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Thinktanks Agenda Austria. Nämlich: Dass der Erhalt unseres Wohlstands auch ohne Wachstum möglich sei. Dass die österreichische Staatsverwaltung zwar teuer sei, aber in hoher Qualität funktioniere. Und: Dass nach Überwindung der (Wirtschafts-) Krise kein Weg an neuen Steuern vorbeiführe.
Aus Schulden herauswachsen
Schellhorn stellt diesen „Fehleinschätzungen“ folgendes entge-gen: Wir müssen rasch zurück auf einen Wachstumskurs. Nur so könne man Wohlstand halten und aus den Staatsschulden „herauswachsen“. Dazu müsse die Regierung konsequent bestrebt sein, die Staatsverwaltung leistungsfähiger zu machen.
Derzeit sei die „Staatsleistung suboptimal“, wie das akute Beispiel der Organisation der Impfungen und der internationale Impfrückstand zeigen würden. Doch gerade eine rasche Durchimpfung sei wichtig, um die Covid-Krise zu überwinden und um auf den wirtschaftlichen Wachstumspfad zurückzukehren. Und nach der Krise müsse die Konsolidierung der Staatsfinanzen verstärkt werden. Denn „Corona ist viel, aber noch nicht alles“, so der Agenda-Austria-Direktor. Er verweist auf den finanzpolitischen Dauerbrenner des demographischen Faktums unserer rasch alternden Bevölkerungsstruktur – und der damit verbundenen, steigenden Pensionslasten.
Spielraum schaffen
Wer das bezahlen soll? Der Staat muss aufpassen. Denn trotz des niedrigen Zinsniveaus bestehe die Gefahr einer „Zinsenfalle“, wenn die gestiegenen Staatsschulden bei niedrigem Wirtschaftswachstum in der Zukunft auf wieder höhere Zinsen stoßen. Schon in der Vergangenheit habe man die Entwicklung des Zinsniveaus nicht korrekt vorhersagen können. Und so sieht Schellhorn drei „zentrale Lösungen“ aus dieser Krise: Wir müssten rasch zurück auf den Wachstumskurs. Der größte Beitrag der Bundesregierung müsse das Bereitstellen einer funktionstüchtigen Staatsverwaltung sein. Und: Nach dieser Krise müsse der ausgabenseitige Konsolidierungskurs verstärkt werden. Ausgaben müssten nicht radikal gekürzt werden, vielmehr wäre sicherzustellen, dass in konjunkturell guten Jahren Budgetüberschüsse anfallen.
Österreich sollte sich ein Beispiel an Schweden nehmen, das halb so hohe Staatsschulden hat wie Österreich. Und dementsprechend mehr Spielraum. Am Beispiel einer Pensionsreform würde das etwa erfordern, dass wir „jedes Jahr drei Monate später in Frühpension gehen“ müssten, um das staatliche Pensionsdefizit bei 20 MrdE jährlich „einzufrieren“. (Anm.: Aktuell liegt es bei 24 MrdE; Tendenz seit Jahrzehnten steigend.)
Ausgabenbremse
Weiters brauche es eine budgetäre „Ausgabenbremse“, die die Ausgabendynamik mit der Inflationshöhe begrenzt. Wobei es auch auf EU-Ebene wünschenswert wäre, die Mitgliedsstaaten anzuhalten, das niedrige Zinsniveau zu nutzen, um Budgets zu konsolidieren. Auch wenn das billionenschwere Füllhorn des Europäischen „Recoveryfonds“ nicht gerade ein Anreiz dazu ist. Schuldenabbau durch Inflation werde hingegen nicht so einfach, denn die Inflationsraten dürften nicht auf frühere Werte über 5 % steigen. Regierungen würden zwar froh sein über Inflation, aber man werde sie nicht so hoch werden lassen, dass sie zu einem kontraproduktiven, konjunkturabwürgenden Vertrauensverlust in Bevölkerung und Wirtschaft führt.
Unsicher bleibt, wie lange die Geldschwemme der EZB noch anhalten wird. Denn die EZB habe derzeit keinen erkennbaren Plan für einen Ausstieg, halte aber bereits 25 % der Staatsanleihen in der EU, so der Agenda-Austria-Direktor, der die Geldpolitik in Frankfurt skeptisch sieht.
Foto: AdobeStock / mekcar